Warum das „wir“ beim redaktionellen Texten ein schmaler Grat ist.
Immer wieder liest man in Intros und Teasern, dass „wir“ dies und das meinen, empfehlen oder raten – vgl. das Intro aus der aktuellen TELEKOM_LIFE-Ausgabe.
Ich halte das für ein gewagtes Spiel: Gut gemeint – Schulterschluss mit dem Leser, auf Augenhöhe begegnet und abgeholt, persönlich und dialogisch. Doch der Absender wird auch stark mit der Innensicht befrachtet. Die Redaktion hält sich für ein kompetentes Expertenteam, kennt sich und ihre Stärken und geht daher selbstbewusst mit einem „wir“ raus.
Nur der Leser könnte das anders sehen. Er nutzt ein Medium, die Nutzung ist vor allem im Netz womöglich flüchtig, der Absender könnte unklar sein. Dann könnte er die Frage stellen: Wer ist „wir“? Wer sind denn die, die er gar nicht kennt? Sich fragen, woher deren Autorität kommt? Und sie in Frage stellen oder vielleicht sogar für eine Anmaßung halten, wenn das, was im Beitrag präsentiert wird, nicht den Erwartungen entspricht oder für falsch gehalten wird.
Gesellschaftlicher Trend zum „wir“
Dass überhaupt jemand „wir“ schreibt, hat mit dem Zeitgeist zu tun. Man hört in der Politik häufig vom gesellschaftlichen Zusammenhalt, der zu stärken sei – ob bewusst oder unbewusst, ein „wir“ stützt und stärkt diesen Anspruch. Gleichzeitig leben wir in Zeiten der Individualisierung. Tut es da nicht gut, im Alleinsein und -tun die Wärme eines wirs zu spüren? Als dritter, paradoxer Gedanke käme noch hinzu, dass wir im Netz „sharen“ „liken“ und so einerseits Gemeinschaften bilden, diese Gemeinschaften aber zugleich nur Individuenwolken sind, weil niemand notwendig den anderen kennt – Scheingemeinschaften also.
Bei starker Konkurrenz kontraproduktiv
Wenn man bedenkt, wie dicht der Medienmarkt besetzt ist, ist das „wir“ wahrscheinlich ein Fehler. Wenn jeder sich als „wir“ vorstellt, woher weiß der Leser dann, bei wem er gerade ist? Das gilt auch für das Beispiel im Bild: Die Marke TELEKOM_LIFE ist nicht so bekannt, dass sie dem User geläufig ist; eine Wiederholung wäre besser gewesen.
Bei starker Konkurrenz, wenn alle wir sind, scheint mir das „wir“ kommunikativ falsch. Dann lieber nochmal den Namen des Mediums nennen. Denn wer seinen Namen nennt, identifiziert sich und unterscheidet sich. Gerade bei noch unbekannten oder neuen Medien halte ich es für angebracht, den Namen zu penetrieren, um die redaktionelle Autorität zu stärken. Ein „wir“ dagegen ist austauschbar und gesichtslos.
Ich räume ein, dass ich die Formulierung auch schon habe durchgehen lassen – s. Bildschirmfoto. Da spielt pragmatisch eine Rolle, dass „wir“ kürzer als TELEKOM_LIFE ist, und der Platz für den Teaser extrem kurz. Dann lieber Inhalt vor Form.
Wenn man sich – aus welchen Gründen auch immer – für das „wir“ entscheidet, dann sollte es allerdings durchgehend im Blatt stehen. Einerseits die Rubrik nüchtern Inhalt nennen (statt z.B. unsere Top-Storys), andererseits in Intros dann „wir“ schreiben, wäre nicht sehr durchdacht. Dann bitte Konsequenz.
Was mich zu einer Schlussbemerkung bringt: „Unsere“ (als besitzanzeigende Variante des „wir“) hat für mein Empfinden etwas Betuliches, Bemutterndes, Trutschiges. Zugegeben ein geschmäcklerischer Punkt, doch ich neige zu der Ansicht, dass „unsere“ nur da passt, wo die Gemeinschaft stark betont wird – z.B. bei Elternzeitschriften.


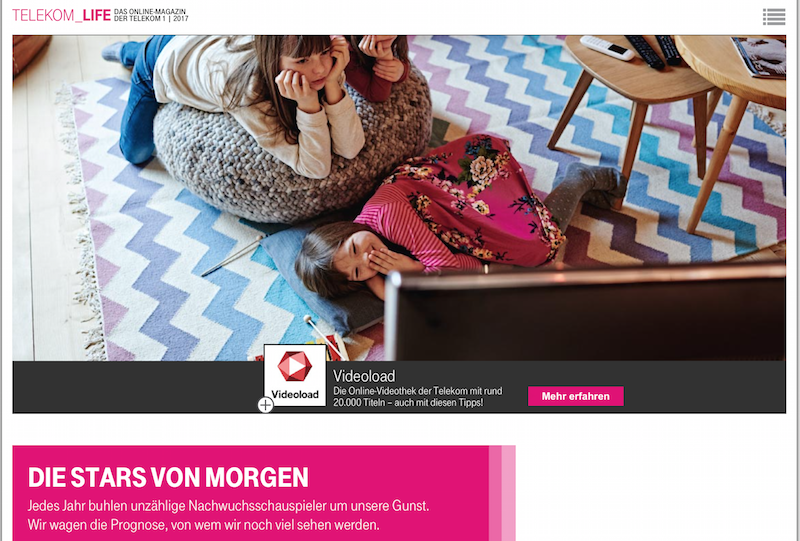
[…] auf meine Mühlen. Mich ließ speziell das „Wir“ aufhorchen, weil ich darüber schon öfter gebloggt habe, mit der Tendenzaussage, dass die Redaktionen mit dem „Wir“ eine Persönlichkeit, […]